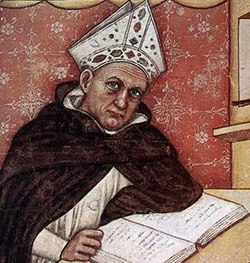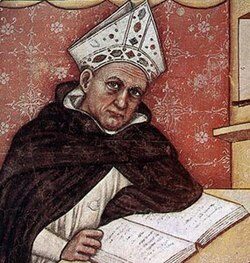Kapitel 1 – Leitbild
Für uns, die Lehrerinnen und Lehrer, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Albertus-Magnus-Schule, ist der christliche Glaube die Grundlage einer Erziehung im Geist des Evangeliums. Wir möchten den jungen Menschen ihre Verantwortung für Gottes Schöpfung und damit für ihre Mitmenschen und die Umwelt bewusst machen. Im Umgang miteinander geht es darum, Nächstenliebe und Solidarität, Gerechtigkeit und Eigenverantwortung, Respekt, Toleranz und Dialogfähigkeit zu leben. Dies ist ein Anliegen aller Mitglieder unserer Schulgemeinschaft. Wir wollen Leben aus dem christlichen Glauben heraus deuten und erfahrbar machen. Jeder Einzelne ist als Abbild Gottes ein wichtiger und wertgeschätzter Mensch unserer Schulgemeinschaft, den wir verstehen und stärken wollen. Katholische Schule bedeutet für uns konfessionelle Bindung und daraus geistige Weite und Offenheit. Unser christlicher Glaube ist Fundament für die respektvolle Begegnung mit Menschen anderer Konfessionen, Religionen und Kulturen. Wir vermitteln unseren Schülerinnen und Schülern ein solides Wissen, fördern ihre Indi-vidualität und Einzigartigkeit als Person und eröffnen ihnen damit vielfältige Lebenschancen. Was wir in unserer Schule tun, geschieht stets in Verantwortung vor Gott.
Kapitel 2 – Besondere Schwerpunkte
Ob Glaube, Sprachen, Naturwissenschaften oder Berufsorientierung – unsere Profile eröffnen individuelle Wege und fördern Talente in vielen Bereichen.
Christliche Grundausrichtung
Die Schule lebt und vermittelt ein christliches Menschenbild. Religiöse Bildung, gelebte Spiritualität im Schulalltag sowie soziales Engagement prägen die Gemeinschaft.
👉 Mehr dazu mit einem Klick …
Altsprachliches Profil
Als altsprachlich geprägtes Gymnasium liegt ein Fokus auf den klassischen Sprachen Latein und Altgriechisch. Die Auseinandersetzung mit Sprache, Kultur und Philosophie fördert ein reflektiertes Europabewusstsein.
👉 Mehr dazu mit einem Klick …
Naturwissenschaftliches Profil
Die AMS ist eine MINT-freundliche Schule. Durch Wettbewerbe, AGs, digitale Bildung und Kooperationen werden naturwissenschaftliches Denken und technologische Kompetenzen gestärkt.
👉 Mehr dazu mit einem Klick …
Berufsorientierung
Vielfältige Projekte und gezielte Maßnahmen unterstützen die Schülerinnen und Schüler dabei, eigene Interessen zu erkennen und fundierte Entscheidungen für Studium und Beruf zu treffen.
👉 Mehr dazu mit einem Klick …
Kapitel 3 – Schulgemeinde
Gemeinsam stark: Das Leben und Lernen an der Albertus-Magnus-Schule wird von einer aktiven und vielfältigen Schulgemeinde getragen. Im Zentrum stehen Vertrauen, Zusammenarbeit und gemeinsame Verantwortung.
Schulleitung
Unsere Schulleitung gestaltet gemeinsam mit Schulträger und Kollegium das Schulleben – werteorientiert, transparent und zukunftsgewandt.
👉 Mehr dazu mit einem Klick …
Lehrerinnen und Lehrer
Unsere Lehrkräfte vermitteln nicht nur Wissen, sondern leben Werte vor – engagiert, persönlich und mit Blick auf die ganze Persönlichkeit.
👉 Mehr dazu mit einem Klick …
Schülerinnen und Schüler
Unsere Schülerinnen und Schüler bringen sich aktiv in das Schulleben ein. Selbstbestimmt, kritisch und verantwortlich gestalten sie ihre Schulgemeinschaft mit.
👉 Mehr dazu mit einem Klick …
Eltern
Elternarbeit ist bei uns gelebte Partnerschaft. Im engen Austausch mit der Schule begleiten und unterstützen sie die Entwicklung ihrer Kinder.
👉 Mehr dazu mit einem Klick …
Gemeinsame Vereinbarungen
Unsere Schulleitung gestaltet gemeinsam mit Schulträger und Kollegium das Schulleben – werteorientiert, transparent und zukunftsgewandt.
👉 Mehr dazu mit einem Klick …
Kapitel 4 – Unsere Fächer
Vielfalt mit System: Unser breites Fächerangebot verbindet klassische Bildungsideale mit modernen Anforderungen – für ein starkes Fundament.
Fachbereich I – Sprachen und Künste
Sprachliche Ausdrucksfähigkeit, kulturelle Bildung und kreatives Gestalten – dieser Bereich umfasst u.a. Deutsch, Fremdsprachen, Kunst und Musik.
Genauere Informationen finden Sie auf der Überblicksseite der Fächer.
Fachbereich II – Gesellschaft & Religion
Als altsprachlich geprägtes Gymnasium liegt ein Fokus auf den klassischen Sprachen Latein und Altgriechisch. Die Auseinandersetzung mit Sprache, Kultur und Philosophie fördert ein reflektiertes Europabewusstsein.
Genauere Informationen finden Sie auf der Überblicksseite der Fächer.
Fachbereich III – Mathematik & Naturwissen-schaften
Die AMS ist eine MINT-freundliche Schule. Durch Wettbewerbe, AGs, digitale Bildung und Kooperationen werden naturwissenschaftliches Denken und technologische Kompetenzen gestärkt.
Genauere Informationen finden mitSie auf der Überblicksseite der Fächer.
Sport
Bewegung fördert Gesundheit, Fairness und Teamgeist – der Sportunterricht stärkt körperliche wie soziale Kompetenzen.
Genauere Informationen finden Sie auf der Überblicksseite der Fächer.
Methodencurriculum
Lernen will gelernt sein. Unsere Methodenschulung unterstützt systematisch das selbstständige, strukturierte Arbeiten über alle Fächer hinweg.
👉 Mehr dazu mit einem Klick …
Kapitel 5: Lebensraum Schule
Mehr als Unterricht: Unsere Schule ist ein Ort der Begegnung, an dem soziales Lernen, individuelle Förderung und ein achtsames Miteinander fest verankert sind – für ein ganzheitliches Aufwachsen.
Sozialen Zusammenhalt fördern.
Miteinander stärken: Rituale, Projekte und Werte schaffen ein soziales Lernumfeld voller Vertrauen und Respekt.
👉 Mehr dazu mit einem Klick …
Problemen vorbeugen
Prävention mit Weitblick: Altersgerechte Angebote fördern Achtsamkeit, Medienkompetenz und Selbstverantwortung.
👉 Mehr dazu mit einem Klick …
Lernen individuell fördern
Lernen im eigenen Tempo: Wir bieten flexible Förderwege, die gezielt auf persönliche Stärken und Schwächen eingehen.
Genauere Informationen finden Sie auf der Seite zur individuellen Förderung.
Überfachliche Kompetenzen stärken
Stark fürs Leben: Persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten werden systematisch und nachhaltig aufgebaut,
👉 Mehr dazu mit einem Klick …
Mittagessen und Nachmittagsbetreuung
Raum zum Wohlfühlen: Verlässliche Betreuung, gesundes Essen und entspannte Pausen gestalten den Tag mit.
👉 Mehr dazu mit einem Klick …
Kapitel 6: Berufsorientierung
Wege finden: Wir begleiten unsere Schülerinnen und Schüler dabei, eigene Interessen zu entdecken und fundierte Entscheidungen für ihre berufliche Zukunft zu treffen – mit Praxisnähe und Perspektive.
Beruf im Team (BiT)
Praxisnah entdecken: In Projekten lernen unsere Schüler echte Berufsfelder im Team kennen und reflektieren Erfahrungen.
👉 Mehr dazu mit einem Klick ….
Berufs- und Studienorientierungstage
Zukunft konkret erleben: Workshops und Gespräche eröffnen realistische Einblicke in Ausbildung und Studium.
👉 Mehr dazu mit einem Klick ….
Betriebspraktika
beitswelt hautnah: Zwei Praktika ermöglichen direkte Erfahrungen im Berufsalltag und fördern Selbstreflexion.
👉 Mehr dazu mit einem Klick ….
Berufsorientierung
Sinnvoll entscheiden: Seminare helfen, Interessen zu entdecken und Wege für Studium oder Ausbildung zu entwickeln.
👉 Mehr dazu mit einem Klick ….
Informationsangebote
Infomaterial, Hochschulkontakte und aktuelle Termine unterstützen unsere Oberstufenschüler bei der Studien- und Berufswahl.
👉 Mehr dazu mit einem Klick ….
Berufswahlpass
Um die Teilnahme an den Projekten und Bausteinen zur Berufs- und Studienorientierung zu dokumentieren, führen die Schülerinnen und Schüler eine Portfoliomappe, den sog. Berufswahlpass, der außerdem durch Informationsmaterialien ergänzt wird.
Kapitel 7: Entwicklungsziele
Zukunft gestalten: Wir entwickeln unsere Schule kontinuierlich weiter – mit klaren Schwerpunkten in Glaube, Digitalisierung, Verantwortung und Gesundheit für ein starkes und zeitgemäßes Bildungsprofil.
Vertiefung des christlichen Profils
Glauben bewusst gestalten: Wir wollen spirituelle Angebote, Wertebildung und soziales Engagement weiter stärken und sichtbarer im Schulalltag verankern.
👉 Mehr dazu mit einem Klick …
Digitale Kompetenz
Fit für morgen werden: Ziel ist es, Medienbildung, IT-Förderung und digitale Verantwortung systematisch auszubauen und fest im Unterricht zu verankern.
👉 Mehr dazu mit einem Klick …
Sprachenvielfalt
Kulturelle Horizonte erweitern: Wir möchten klassische und moderne Fremdsprachen weiter stärken, um interkulturelle Kompetenz gezielt zu fördern.
👉 Mehr dazu mit einem Klick …
Stärkung sozialer Verantwortung
Gesellschaft mitgestalten lernen: Projekte und Initiativen zur Förderung von Empathie, Nachhaltigkeit und Engagement sollen weiterentwickelt werden.
👉 Mehr dazu mit einem Klick …
Lehrergesundheit
Lehrkräfte stärken: Wir arbeiten daran, gesundheitsfördernde Strukturen für das Kollegium zu schaffen und langfristig zu etablieren.
👉 Mehr dazu mit einem Klick …
Lernen lernen
Selbstständigkeit fördern: Ziel ist es, Methodenkompetenz und reflektiertes Lernen systematisch in allen Jahrgangsstufen weiterzuentwickeln.
👉 Mehr dazu mit einem Klick …